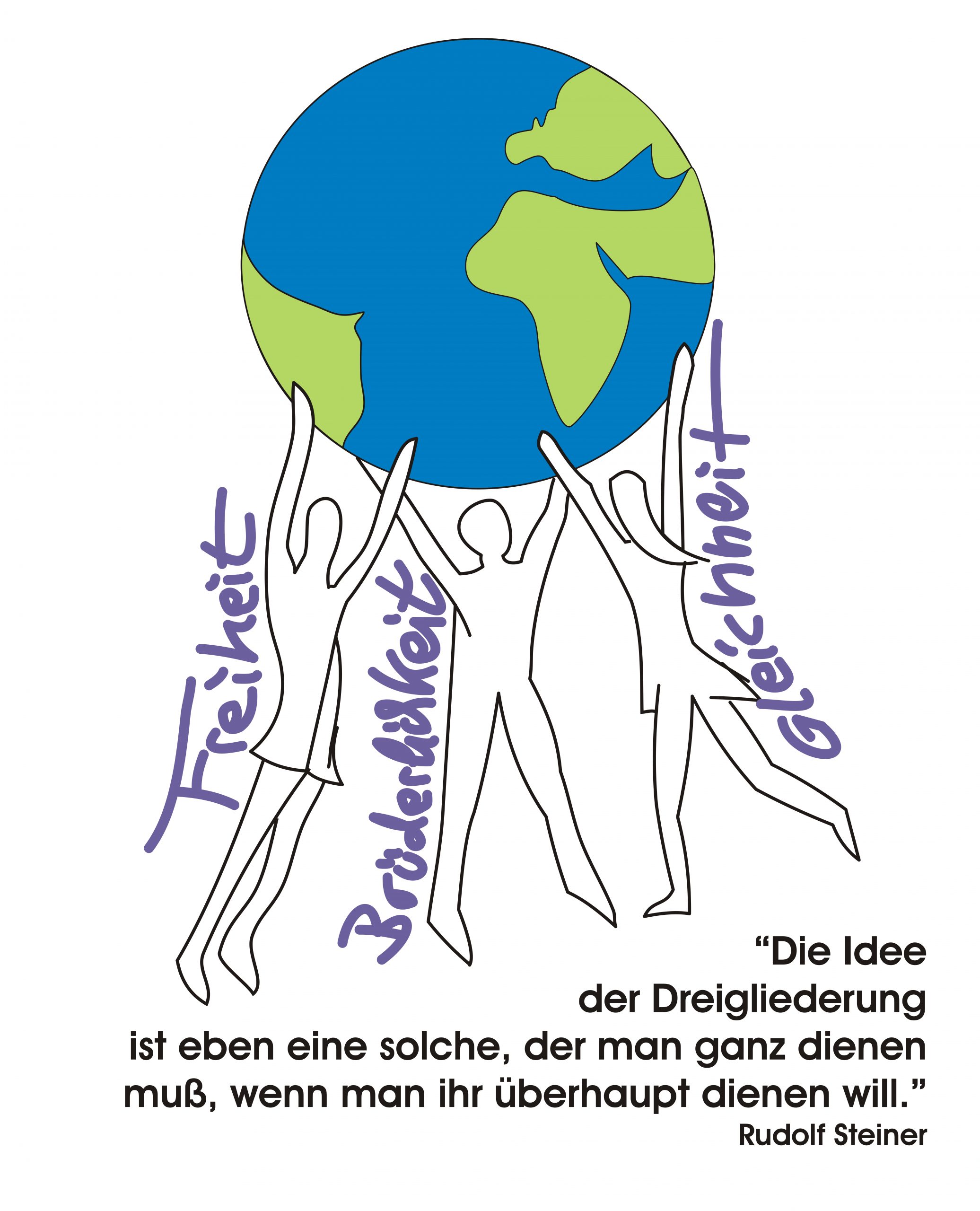Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns erst einmal mit der Funktionsweise beschäftigen. Was sind Bitcoins? Wie entstehen sie? Wie ist ihre soziale Wirkung, was bedeuten sie für unsere sozialen Zusammenhänge?
Der Bitcoin behauptet von sich, die älteste und größte digitale Währung zu sein, auch Kryptowährung genannt. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil inzwischen im Prinzip alle Währungen digital gehandelt werden. Übersetzt sind Bitcoins digitale Münzen. Das trifft es gut, denn Bitcoins werden rein elektronisch erschaffen und verwahrt – dezentral und weltweit auf weltweit vernetzten Computern. Bitcoins entstehen durch das sogenannte Mining (schürfen), einen komplizierter mathematischer Prozess, der viel Rechenleistung benötigt.
Bitcoins sollen aus einer Reaktion auf die von Großbanken ausgelöste Finanzkrise 2008 entstanden sein. Der Erfinder oder die Erfinderin ist jedoch bis heute unbekannt. Er oder sie ist unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt. „Satoshi“ oder kurz „Sat“ heißt auch die kleinste Einheit des Bitcoin.
Den Entwurf zu Bitcoin veröffentlichte der Erfinder oder die Erfinderin 2008. Die Idee fand schnell Interesse, zunächst vor allem bei Nutzern, die unabhängig von Staaten und Zentralbanken sein wollten. Mittlerweile hat der Bitcoin eine große Nutzergemeinde auf der ganzen Welt. Mit El Salvador hat sogar 2021 ein Staat Bitcoin als offizielle Währung eingeführt. Der Grund für die große Nachfrage nach Bitcoins liegt auch daran, dass immer mehr Geld, dass eigentlich nicht gebraucht wird, nach neuen Anlagemöglichkeiten sucht.
Die Idee des Bitcoins ist es, ein digitales Geldsystem zu etablieren, das keiner staatlichen Kontrolle unterliegt. Bedeutet: Mitglieder im Netzwerk können einander weltweit Geld übertragen und prüfen selbst sämtliche Transaktionen. Auch im Nachhinein soll niemand im Netzwerk Übertragungen von Bitcoins manipulieren oder zurücknehmen können.
Das wird erreicht durch die sogenannte Blockchaintechnologie. Die Bitcoin-Blockchain ist das digitale Verzeichnis, in dem alle Bitcoin-Transaktionen gespeichert sind. Alle Mitglieder im Netzwerk können Transaktionen überprüfen, und leistungsstarke Computer betten diese in eine aufwendige Rechenaufgabe ein. Das sollBetrug erschweren.
Bitcoins werden auch als Kryptowährung bezeichnet, weil Kryptographie, also Verschlüsselungstechnik, eine entscheidende Rolle beim Erstellen der Blockchain spielt. Schließlich soll etwas vermieden werden, was bei rein digitalen Gütern im Grund üblich ist: dass eine Kopie nicht vom Original zu unterscheiden ist und digitales Falschgeld den Markt flutet.
Es gibt neben dem Bitcoin viele andere Kryptowährungen. Manche, wie Bitcoin Cash, sind aus dem Bitcoin abgeleitet, andere, wie Ether (Ethereum), wurden separat entwickelt und haben deutlich mehr technische Möglichkeiten als die Bitcoin-Blockchain. Der Bitcoin selbst ist mit rund 57 Prozent Marktanteil aller Kryptowährungen aber weiterhin die bekannteste und am meisten verbreitete (Stand: Oktober 2024).
Bitcoins werden in einem Wallet (elektronische Geldbörse) aufbewahrt. Es gibt viele professionelle Anbieter, die für die Eigner (gegen Gebühren) Wallets verwalten. Wallets sind Hardware-gebunden und Passwort gesichert. Verliert man das Passwort, gibt es keine Möglichkeit, auf das Wallet zuzugreifen. Dann sind die Bitcoins verloren. Schätzungen des Blockchainanalyse-Unternehmens Chainalysis zufolge könnten etwa 20 Prozent aller jemals erstellten Bitcoin verlorenen gegangen sein, weil Passwörter oder Festplatten abhandengekommen sind. Das wären nach aktuellem Wert des Bitcoin mehrere Hundert Milliarden Euro.
Bitcoin-Übertragungen gelten als besonders sicher und nicht manipulierbar. Vermittlungspartner wie Banken, die bei einer Überweisung das Geld von einem Konto abziehen und es auf einem anderen gutschreiben, gibt es nicht. Stattdessen übernehmen Verschlüsselungstechnologien und die Rechenleistung des Netzwerkes diesen Job.
Bei jeder Überweisung fällt eine sogenannte Netzwerkgebühr an. Diese variiert in der Höhe und hängt davon ab, wie schnell der User seine Transaktion ausgeführt haben möchte. Wer von einer Börse zu einem Wallet überweist, zahlt in der Regel mehr – die Übertragung soll möglichst in zehn Minuten erfolgt sein. Die Börse legt dabei die Gebühr fest. Wer dagegen von Wallet zu Wallet überweist, kann die Gebühr selbst bestimmen. Nutzer, die wenig bezahlen wollen, warten dann einfach länger auf die Transaktion.
Jeder Besitzer eines digitalen Geldbeutels bekommt einen sogenannten Public Key, also eine Bitcoin-Adresse beziehungsweise ein Set solcher Bitcoin-Adressen zugeteilt. Sie bestehen jeweils aus einer Reihe zufällig generierter Zahlen und Buchstaben, zum Beispiel K3uhvdwu7BoiWTP9mmjuW9A. Wallet-Besitzende können sich dann von einer Adresse zur anderen Geldbeträge in Bitcoins schicken.
Um die Übertragung abzusichern, braucht es zusätzlich einen sogenannten privaten Schlüssel, einen Private Key. Er wird beim Anlegen des Wallets erzeugt. Der private Schlüssel wird entweder privat gespeichert oder ist direkt in der Hardware verbaut – und er ist geheim. Niemand kann ihn so ohne Weiteres offenlegen. Eine Übertragung wird am Ende nur freigegeben, wenn der private Schlüssel genau zum Wallet passt. Einmal freigegeben, werden Übertragungen in der Blockchain festgehalten und können nicht mehr verändert oder rückgängig gemacht werden.
Bis eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk verbucht ist, dauert es bestenfalls etwa zehn Minuten. Wenn viele Transaktionen zur gleichen Zeit laufen, kann die Verbuchungszeit jedoch erheblich ansteigen und teilweise mehrere Tage dauern. Der Grund: Die Überweisungen sind in einen mehrstufigen Rechenprozess eingebunden.
Die Blockchain ist ein digitales Register, in dem jede einzelne Bitcoin-Übertragung gespeichert ist. Dahinter steht die Blockchain-Technologie, ein Konzept, das Betrug deutlich erschwert. Vereinfacht gesprochen funktioniert das so:
Prüfung 1: Übertragung gedeckt?
Das digitale Register Blockchain besteht aus einzelnen Registerkarten, die wie in einem Ordner der Reihe nach digital „abgeheftet“ werden. Auf jeder Registerkarte werden verschiedene Übertragungen gespeichert. Ist die Karte voll, überprüft die Bitcoin-Community, ob der angewiesene Bitcoin-Betrag tatsächlich im Wallet vorhanden ist und ob der Nutzer oder die Nutzerin die Bitcoins auch wirklich nur einmal angewiesen hat. Nur wenn alles passt, geht es weiter.
Der Registerkarte wird nun eine knifflige Rechenaufgabe zugewiesen. Um sie zu lösen, rechnen viele Computer im Netzwerk um die Wette. Am Ende findet einer den eindeutigen Lösungsweg. Dieser Lösungsweg dient dann als eine Art Siegel für die Registerkarte. In der Blockchain-Welt nennt man die versiegelte Karte Block. Viele versiegelte Karten nacheinander „abgeheftet“ bilden die Kette, englisch: chain.
Prüfung 2: Richtiger Lösungsweg?
Würde jemand eine Übertragung auf der Registerkarte nachträglich manipulieren, würde sich die Rechenaufgabe verändern – und dementsprechend auch der Lösungsweg. Im digitalen Register stünde plötzlich ein falscher Lösungsweg. Weil jedes vollwertige Mitglied im Netzwerk den Blockchain-Datensatz zuhause auf dem Rechner hat und überprüfen kann, würde diese Veränderung sofort auffallen.
Dieser Prüfvorgang kann mit dem jahrhundertealten Prinzip des Kerbholzes verglichen werden, bei dem zwei Geschäftspartner jeweils eine Hälfte eines Brettchens besaßen. Für eine neue Markierung musste man beide Hälften genau nebeneinanderlegen und eine Kerbe einritzen. Keiner der beiden Partner konnte die Notiz einseitig verändern, nur gemeinsam mit dem anderen. Die Blockchain hat sozusagen viele Tausend Kerbholz-Teile, was Manipulationen sehr unwahrscheinlich macht.
Vollwertige Mitglieder im Netzwerk haben die Blockchain auf ihrem Rechner abgespeichert. Sie sind damit Knotenpunkte (englisch: nodes) und nutzen in der Regel Wallets, die direkt auf dem Computer laufen. Wer Bitcoins auf dem Handy oder online verwahrt, nutzt zwar die Bitcoin-Technologie, hat die Blockchain aber in der Regel nicht vollständig heruntergeladen und kann daher nicht aktiv in Prozesse eingreifen. Er kann auch keine neuen Bitcoins herstellen. Eine Kopie der Bitcoin-Blockchain umfasste im Frühjahr 2024 über 500 Gigabyte Speicherplatz.
Wie entstehen neue Bitcoins?
Neue Bitcoins gibt es als Belohnung für das Netzwerk-Mitglied, dessen Computer es als erstes geschafft hat, den eindeutigen Lösungsweg für die Rechenaufgabe zu finden und damit die Registerkarte zu versiegeln, also einen Block herzustellen. Eine Belohnung ist deshalb angebracht, weil es enorme Rechenzeit und Energie braucht, den Lösungsweg zu bestimmen.
Die Frage, wie umweltschädlich der Bitcoin ist, wird heiß diskutiert. Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht so viel Strom wie ein mittelgroßes Land, beispielsweise Schweden. Für die Erstellung neuer Coins und die Fortschreibung der Blockchain sind enorme Rechenzentren erforderlich, die einen hohen CO2-Ausstoß verursachen.
Bitcoin-Mining
Die Bitcoin-Sprache vergleicht die aufwendige Berechnung des eindeutigen Lösungswegs mit der Arbeit von Minenarbeitskräften (englisch: Miner). Der Rechner, der die Aufgabe als erster löst, fährt den Lohn seiner Arbeit ein: Er hat neue Bitcoins „geschürft“ (englisch: mined) und die Belohnung wird dem verknüpften Wallet gutgeschrieben.
Bitcoins-Obergrenze
Das Bitcoin-Netzwerk hat sich selbst die Grenze von 21 Millionen Bitcoins gesetzt, die jedoch erst im Jahr 2140 erreicht werden soll. Die Obergrenze ist ein zentrales Element des Bitcoin-Zahlungssystems, um Inflation zu verhindern. Ende September 2024 waren rund 19,8 Millionen Bitcoins im Umlauf. Der Schürfprozess verlangsamt sich, weil der Anreiz für das Schürfen in regelmäßigen Abständen gesenkt wird.
Bitcoin-Halving
Das Schürfen neuer Bitcoins wird alle paar Jahre künstlich gebremst. Dieser Vorgang wird als Halving bezeichnet. Die Belohnung wird halbiert, die derjenige bekommt, der einen neuen Block der Blockchain geprüft hat. Am 20. April 2024 fand das bisher letzte Bitcoin-Halving statt. Da neue Bitcoin nur in Form dieser Belohnung in Umlauf gebracht werden können, entspricht die Wachstumsrate also aktuell etwa 450 neuen Bitcoins pro Tag. Das nächste Halving wird im Jahr 2028 stattfinden.
Bedeutung von Bitcoins im sozialen Zusammenhang
Um uns dieser Frage etwas zu nähern, müssen wir erst einmal die Bedeutung von Geld näher betrachten. Was ist Geld eigentlich? Um diese Frage zu beantworten ist es sinnvoll, die Entwicklung des Geldes in der Geschichte anzusehen.
Bis zur Ägyptischen Hochkultur waren die sozialen Verhältnisse zur Selbstversorgung organisiert: Stammes- oder Familiengemeinschaften produzierten für ihren eigenen Bedarf. Erst dann begannen die Menschen langsam mit dem Tausch von Waren. Was nicht selber direkt benötigt wurde, tauschte man gegen andere Waren, die man selber nicht herstellte. Damit einher ging natürlich eine Art von Spezialisierung. Die Waren wurden in den Tempel gebracht, wo der Priester mit seiner geistigen Einsicht das Tauschverhältnis (Preis) festlegte. Es war ihm bekannt, dass dieses Tauschverhältnis unmittelbare Auswirkung auf die sozialen Verhältnisse hat: Ein schlechter Tausch konnte für die Beteiligten Hunger und Not bedeuten.
Der Tauschhandel etablierte sich und löste sich auch langsam aus dem Tempel. Im direkten Tausch Ware gegen Ware gibt es zwei grundlegende Probleme:
-
Waren sind teilweise nur begrenzt lagerfähig (Lebensmittel)
-
Tauschhandel kommt nur zustande, wenn beide Tauschpartner etwas anbieten, was der andere braucht
Um diese Begrenzung des Tauschhandels zu überwinden tauchen erste Geldformen auf, zunächst in Form von Metallstücken und -münzen aus Gold, Silber, Kupfer und sogar Eisen. Sie habe Götterköpfe oder -symbole als Prägung, später Köpfe und Wappen der Herrschaftshäuser. Das Geld steht praktisch im Tauschvorgang zwischen den Tauschpartnern, teilt diesen in zwei Teile: Waren werden gegen Geld eingetauscht, Geld wieder gegen Waren. Möglicher Tauschpartner ist nun jeder, da mit dem erlösten Geld alles gekauft werden kann. Es entfällt auch das Problem der begrenzt lagerfähigen Waren. Diese Vorteile des Geldes sorgen dann auch für eine rasante Verbreitung, Handel entsteht.
Der Erwerb einer Goldmünze durch den Verkauf von Waren war nicht wegen des Goldwertes, sondern wegen der Berechtigung, bei einem beliebigen Partner Waren zur Bedürfnisbefriedigung zu erwerben. Damit war das Geld ein „Anspruchdokument“, ein „Warenbezugs-Berechtigungsschein“, ein Rechtsdokument. Das Geld an sich hat inzwischen keinen Wert mehr, berechtigt ledigtlich zum Bezug von anderen Waren. Das Geld hatte oft zusätzlich einen Metallwert, weshalb es auch in unsicheren Zeiten als Zahlungsmittel akzeptiert wurde.
Halten wir fest: Geld an sich hat keinen Wert! Es ist ein reines Rechtsdokument, ein Warenbezugs-berechtigungsschein. Es steht praktisch im Tausch genau in der Mitte. Dadurch, dass ich eine Ware (oder Dienstleistung) abgegeben habe, erhalte ich die Berechtigung, andere Waren (oder Dienstleistungen) zu beziehen. Dafür muß dann ein anderer Mensch eine Leistung erbringen.
Wenn ich nun mein erhaltenes Geld nicht ausgebe, sondern zurückhalte (spare), besteht die Gefahr, dass dann, wenn ich es später wieder ausgeben möchte, niemand mehr da ist, der eine angemessene Leistung dafür erbringen will oder kann. Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Leistungserbringern ist durch diese zeitliche Verschiebung gestört. Wenn ich nun mein Geld durch Zins und Zinseszins mehre, verstärkt sich dieser Effekt noch stark, da ich für den Zinseszins keine reale Leistung erbracht habe. Es wird nicht immer gleich sichtbar, aber wenn ich einen „Gewinn“ mache, gibt es jemanden anderen, der dafür bezahlt. Unsere komplexe arbeitsteilige Wirtschaft ist wie eine große Buchhaltung aufgebaut. Die oberste Regel für eine Buchhaltung lautet jedoch: Keine Buchung ohne Gegenbuchung! Es stellt sich also die Frage, wer dafür bezahlt, wenn ich einen Geldgewinn mache, ohne etwas dafür zu tun?
Bitcoins entstehen durch einen komplizierten Rechenvorgang aus dem Nichts. Es wurde keine menschliche Leistung für sie erbracht, lediglich eine Rechnerleistung. Bitcoins sind als reines Zahlungsmittel ungeeignet. Es gibt zu wenig Möglichkeiten, mit Bitcoin zu bezahlen und die Transaktionen sind zu umständlich, dauern zu lange und sind auch zu teuer. Daran wird sich in nächster Zeit auch nichts ändern. Also handelt es sich um eine neue reine Spekulationsblase. Was bedeutet das?
Durch die künstliche Verknappung (Bitcoins sind in ihrer Menge begrenzt auf 21.000.000,- ) und die steigende Nachfrage entsteht eine Art Schneeball-System: Neu hinzu gekommene Bitcoin-Käufer zahlen den „Gewinn“ derjenigen, die Ihnen Bitcoins verkaufen. Das sind teilweise natürlich auch die Trader, die neue Bitcoins ’schürfen‘. Aber die Menge ist begrenzt und das Schürfen wird durch immer kompliziertere Rechenprozesse erschwert. So entsteht eine immer größer werdende Spekulationsblase, in der die neuen Bitcoin-Käufer die vermeintlichen Kursgewinne der anderen bezahlen. Doch jedes Schneeball-System bricht spätestens dann zusammen, wenn nicht mehr genügend neue Mitglieder ständig aquiriert werden können! Dann wird es viele Tränen geben, wenn sich die vermeintlichen hohen Buchwerte plötzlich in Luft auflösen. Derzeit können noch immer neue Menschen gefunden werden, die, getrieben durch Gier, zusätzliches Geld einbringen. Auch wird zunehmend im Internet dafür geworben. Aber wie lange hält das noch an, bevor das gesamte System zusammenbricht?
Wie so oft in der Vergangenheit entsteht auch hier durch die Aussicht auf schnellem Profit ein Tummelplatz an ‚halbseidenen‘ Geschäftemachern und Spekulanten. Ein paar Handelsplattformen sind auch schon verschwunden, große Summen von (vermeintlichen) Guthaben lösten sich ebenfalls in Luft auf.
Die Ironie der ganzen Entwicklung ist, dass die Urheber des Bitcoins ursprünglich als Grund angaben, ein Gegenmittel gegen die Spekulationsblasen aus der Krise 2008-2009 entwickelt zu haben. Der Erfolg ist, dass sie eine noch viel größere Spekulationsblase aufgemacht haben!
Diese Blasen haben zwar mit unserem realen Warenverkehr recht wenig zu tun, ein größerer Zusammenbruch kann aber durch die Irritationen diesen durchaus ebenfalls ins Stocken bringen. Kaum jemand kann voraussehen was passiert, wenn die Bitcoinblase in größerem Zusammenhang platzt. Wahrscheinlich ist, dass dies Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Menschen hat.
Bitcoin aus geistiger Sicht
Wie so oft in unserer schönen modernen Welt scheinen hier die beiden Widersacher Hand in Hand zusammen zu arbeiten: Das ‚Schürfen‘ neuer Bitcoins sowie alle Buchungsvorgänge sind an komplexe Rechenvorgänge gebunden, die so kompliziert sind, dass große Rechenzentren immense Mengen an Strom verbrauchen. Die Buchungsvorgänge sind ohne Maschine nicht machbar. Hier hat Ahriman die Kontrolle komplett übernommen. Wir sind abhängig von den Rechenleistungen der Maschine und können nicht mehr von Hand eingreifen. Man wollte aus der Abhängigkeit von Banken und Regierungen kommen, um nun von Maschinen und vielen windigen Geschäftemachern abhängig zu sein.
Bei der Illusion des Wertes der Bitcoins gaukelt uns Luzifer vor, wir wären reich. Dabei handelt es sich lediglich um eine Zahl in einer Buchhaltung. Die Frage, ob es dann Menschen gibt, die für diese virtuelle Zahl eine Leistung erbringen können oder wollen, steht auf einem ganz anderen Blatt und ist dann doch eher wieder eine soziale Frage. Wenn ich allerdings für diese Buchungszahl tatsächlich kein Leistung erbracht habe und nun eine andere Leistung einfordere, bringe ich das soziale Gleichgewicht durcheinander und bewirke, dass andere Menschen für ihre Leistungen nicht mehr genügend zum Leben bekommen. Es entsteht Not und Elend. Wir brauchen nur hinzusehen. Es gibt inzwischen genügend Menschen, die von ihrer Hände Arbeit nicht leben können.
Die Investition in Bitcoin wird in letzter Zeit sehr stark beworben. Dabei wird immer wieder gesagt, man solle möglichst nur Geld investieren, welches nicht dringend gebraucht würde. Dieses ‚Überflußgeld‘, also Geld, welches man nicht unmittelbar braucht, gehört jedoch in das Geistesleben zur Finanzierung von Bildung, Kunst und Kultur. Kein Wunder, dass dort ständig Mangel herrscht, wenn das Geld stattdessen in der Spekulation landet.
Ich will das alles nicht pauschal ‚verteufeln‘. Jeder kann selber entscheiden, was er warum tut. Mein Anliegen ist, Klarheit zu schaffen in einer immer komplizierter werdenden Welt. Klarheit über die soziale (oder antisoziale) Wirkung unseres wirtschaftlichen Handelns. Wir sind im Alltag in eine Unmenge von kleinen Wirtschaftsvorgängen eingebunden. Sei es beim Einkaufen, bei der Beauftragung eines Handwerkers, beim Ausleihen einer Bohrmaschine oder bei der Hilfe unter Nachbarn. Jedem dieser Vorgänge geht eine freie Entscheidung voraus. Und jeder dieser Vorgänge hat eine soziale Wirkung, die leider oft nicht unmittelbar sichtbar ist. Aber auch wenn wir die Wirkungen unseres wirtschaftlichen Handelns oft nicht sehen, bleiben es Wirkungen. Ich möchte, dass wir bewußt auf diese Wirkungen schauen, seien die Vorgänge auch noch so kompliziert. Dann können wir in Freiheit entscheiden und tragen die karmische Verantwortung dafür.